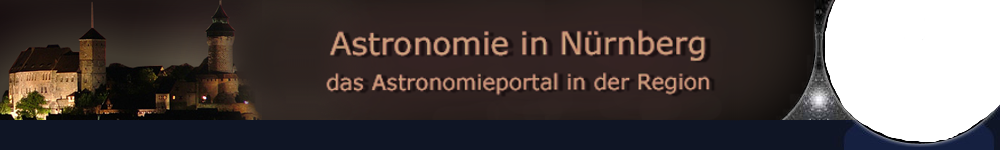Die nach Homanns Vorgaben von Landeck angefertigte Geographische Universal-Zeig- und Schlag-Uhr.
Zacharias Landeck und seine Söhne
Stadt- und Landalmosenuhrmacher in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.- Der Vater:
- Zacharias Landeck, * 23.08.1670[1];
† 19.09.1740[2]
- Vater: Johann Carl Landeck (16.12.1636-15.07.1712).
- Mutter: Catharina (20.08.1645-04.02.1722).
- Heirat: 24.04.1702 in Wöhrd,[3] Ursula Barbara Scheffler (10.09.1680[4]-31.10.1760[5]), Tochter des Johann Georg Scheffler.
-
Kinder: 6 Söhne, 4 Töchter.
1. Kind: Maria Magdalena 18.03.1703-? Taufen St. Sebald 1702-1724, S. 40 2. Kind: Johann Adam 21.03.1704-? Taufen St. Lorenz 1693-1712, S. 481 3. Kind: Maria Eleonora 05.11.1706-? Taufen St. Lorenz 1693-1712, S. 486 4. Kind: Lorenz Heinrich 15.04.1708-? Taufen St. Lorenz 1693-1712, S. 488 5. Kind: Maria Magdalena 08.05.1710-01.05.1766 Taufen St. Lorenz 1693-1712, S. 492
Best. St. Sebald 1755-1768, S. 5806. Kind: Christoph Zacharias 25.08.1712-? Taufen St. Lorenz 1693-1712, S. 496 7. Kind: Wolf Jacob Matthäus 03.05.1715-03.07.1794 Taufen St. Sebald 1702-1724, S. 558
Best. Mögeldorf 1730-1851, S. 3738. Kind: Christoph Achatius 03.03.1717-04.02.1771 Taufen St. Sebald 1702-1724, S. 673
Best. St. Sebald 1769-1779, S. 1039. Kind: Maria 22.03.1719-? Taufen St. Sebald 1702-1724, S. 799 10. Kind: Johann Melchior 08.06.1721-16.07.1759 Taufen St. Sebald 1702-1724, S. 917
Best. St. Sebald 1755-1768, S. 155
- Die Söhne:
- Johann Adam Landeck, * 21.03.1704[6]; † ?
- Heirat: 26.06.1746 in Mögeldorf,[7] Anna Maria (21.10.1718[8]-28.07.1752[9]), Tochter von Andreas Seger.
-
Kinder: Mindestens 4 Töchter.
1. Kind: Margarethe Agatha * 05.03.1748 Taufen Ansbach-St. Johannis 1736-1754, S. 336/14 2. Kind: Maria Magdalena * 17.05.1749
† 23.03.1752Taufen Ansbach-St. Johannis 1736-1754, S. 367/12
Best. Ansbach-St. Johannis 1742-1772, S. 79/843. Kind: Maria Elisab. Barb. * 11.08.1750 Taufen Ansbach-St. Johannis 1736-1754, S. 398/1 4. Kind: Clara Margaretha * 25.07.1752
† 23.11.1752Taufen Ansbach-St. Johannes 1736-1754, S. 451/5
Best. Ansbach-St. Johannis 1742-1772, S. 83/277
- Wolf Jacob Matthäus Landeck, * 03.05.1715[10];
† 03.07.1794[11]
- Heirat: 10.12.1750, Evang.-Luth. Stadtkirche Weimar:[12] Maria Philippina (1722-05.06.1772[13]), Tochter des Weimarer Tischlermeisters Bartolomeus Lieber.
-
Kinder: 1 Sohn, 3 Töchter.
1. Kind: Johann Caspar 26.03.1751-13.11.1822 Taufen Weimar 1750-1762, S. 16
Best. Mögeldorf 1730-1851, S. 5362. Kind: Wilhelmina Caroline Maria 04.03.1753-? Taufen Weimar 1750-1762, S. 66b 3. Kind: Sophia Rebecca Ernestina 17.03.1754-28.01.1756 Taufen Weimar 1750-1762, S. 94 4. Kind: Sophia Helena Antonetta 18.09.1758-? Taufen Weimar 1750-1762, S. 211
- Christoph Achatius Landeck, * 03.03.1717[14];
† 06.02.1771[15]
- Heirat: 05.06.1742 in St. Lorenz,[16] Susanna Maria, Tochter von Hieronymus Filzhofer (?-22.03.1748[17]).
-
Kinder: 4 Söhne, 4 Töchter.
1. Kind: Ursula Barbara 19.12.1743-? Taufen St. Sebald 1725-1748, S. 705 Ursula Barbara heiratete am 10.07.1770 den Kupferstecher Johann Georg Sturm (09.03.1742-09.04.1793). 2. Kind: Hieronymus 04.04.1745-? Taufen St. Lorenz 1736-1751, S. 483 3. Kind: Barbara Rosina 07.04.1747-? Taufen St. Lorenz 1736-1751, S. 487 4. Kind: Johann David 14.12.1749-? Taufen St. Lorenz 1736-1751, S. 492 5. Kind: Johannes 11.03.1752-? Taufen St. Sebald 1749-1769, S. 125 6. Kind: Anna Maria 18.08.1754-? Taufen St. Sebald 1749-1769, S. 238 7. Kind: Johann Georg 23.10.1759-03.10.1832 Taufen St. Lorenz 1752-1765, S. 400
Best. St. Lorenz 1823-1832, S. 1658. Kind: Maria Magdalena 09.06.1762-08.05.1773 Taufen St. Sebald 1749-1769, S. 584
Best. St. Sebald 1769-1779, S. 208
- Johann Melchior Landeck, * 08.06.1721[18]; † 16.07.1759[19]
Lebenslauf:
Zacharias Landeck wurde am 18. August 1701 Meister und erhielt im folgenden Jahr das Meisterrecht. 1702 erwarb er um 1950 fl. ein Haus hinter der Egidienkirche (heutige Adresse: Egidienplatz 30), worin er bis zu seinem Tod wohnte. Er starb im September 1740.
Johann Adam Landeck ließ zwischen 1748 und 1752 4 Töchter in Ansbach taufen. Dabei wird er als Uhrmacher bezeichnet, erst bei der Taufe der 4. Tochter ist er Hofuhrmacher. 1752 sterben sowohl seine Ehefrau als auch zwei seiner Töchter. Abeler verzeichnet eine Stutzuhr (kleine Standuhr) mit den Initialien J. A. L. A., die 1992 auf einer Auktion in Genf versteigert wurde. Die Datierung auf um 1680 kann dann aber nicht stimmen. Auch ein kleiner Tischzappler mit Spindelhemmung, also eine federgetriebene Tischuhr mit kleinem Pendel, die vor dem Ziffernblatt schwingt bzw. zappelt, und auf um 1760 datiert wird, dürfte von Johann Adam Landeck angefertigt worden sein, auch wenn dessen Vornamen nicht genannt werden. Diese Uhr wurde 1985 bei Kegelmann in Frankfurt/M. versteigert.
Laut Speckhart und Zinner war Zacharias Landeck Besitzer eines Herrensitzes im (damaligen) Nürnberger Vorort Mögeldorf. Es handelt sich um das sog. Baderschloss mit der heutigen Adresse Mögeldorfer Hauptstraße 55. Leo Bayer, der die Häusergeschichte von Mögeldorf untersuchte, konnte aber nur für 1736 Johann Matthias Landeck als Besitzer feststellen. Damit ist Jakob Matthäus Landeck (1715-1794), der Sohn von Zacharias Landeck gemeint, der das Schloss vor 1750 erwarb. Nach dem Eintrag im Bestattungsbuch von Mögeldorf war der "Fürstlich Sachsen-Weimarischer Hofuhrmacher und Besitzer des Landeckischen Schloßes".
Jakob Matthäus Landeck vererbte das Schloss an seinen Sohn Johann Caspar Landeck (26.03.1751-13.11.1822). Laut Eintrag im Bestattungsbuch[23] war der in Weimar geboren und "gewesener Schloßbesitzer und Kleinuhrmacher in Mögeldorf". 1795 befand sich das Schloss im Besitz von Hans Christoph Wilhelm von Imhoff, d.h. der Sohn musste es unmittelbar nach dem Tod seines Vaters verkaufen. Er starb in großer Dürftigkeit an der "Wassersucht" und war damals 71 Jahre, 7 Monate und 14 Tage alt, somit muss er am 31.03.1751 geboren worden sein. Er war der letzte Uhrmacher der Familie Landeck.
Christoph Achatius Landeck wurde am 17.05.1742 in die Meisterliste eingetragen (Stadtarchiv Nürnberg: E 5/61 Nr. 4, Meisterbuch der Schlosser). Bei der Taufe seiner ersten beiden Kinder wurde er als Uhrmacher bezeichnet, 1747 als Stadtuhrmacher und 1754 schließlich als "Stadt u. Almoß-Uhrmacher". Bei seinem Tod wohnte er "im Egidien Hof", also auf dem heutigen Egidenplatz. Laut Abeler wurde 1885 bei der Internationalen Ausstellung in Nürnberg eine Uhr mit Monatstagen und Sekundenpendel von Christoph Achatius Landeck gezeigt.
Johann Melchior Landeck wurde Kupferstecher. Bei seinem Tod wohnte er in der Neuen Gassen, "am Spitalkirchhof", also in der heutigen Tucherstraße.
Wirken:
Nach Abeler befinden sich im Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart zwei nicht näher datierte Sackuhren von Landeck sowie eine Stockuhr von 1715. Nach Zinner stellte er 1715 für die Universität in Altdorf für 60 Gulden eine Pendeluhr mit Minuten- und Sekundenanzeige her, die monatlich aufzuziehen war. Das bekannteste Werk von Zacharias Landeck ist aber die "Geographische Universal-Zeig und Schlag-Uhr", die er 1705 nach Anweisungen von Johann Baptista Homann (1664-1724) herstellte. Homann hatte dazu auch einen Einblattdruck herausgebracht, auf der er die Uhr näher beschrieb und der dem Jesuiten Johannes Klein (1684-1762) in Prag als Vorlage für dessen Uhr diente. Mit Homann’s Geographischer Uhr konnte auf der nördlichen Erdhalbkugel der Mittagsstand der Sonne sowie die Tageslänge und die Zeiten des Sonnenauf- und untergangs angezeigt werden. Diese Uhr stand ursprünglich im Fembohaus in Nürnberg, war jedoch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verkauft worden. 1905 konnte sie der Nürnberger Hofuhrmachermeister Gustav Speckhart (1852-1919) in Worms erwerben. Er restaurierte die Uhr und fertigte eine kleine Schrift über sie an. Nach Speckharts Tod gelangte sie in den Besitz des Hamburger Sammlers Dr. Heinrich Niels Antoine-Feill (1855-1922), dessen Uhrensammlung am 24. März 1955 in Köln versteigert wurde. Am 7. Mai 2005 wurde die Uhr in Mannheim erneut versteigert. Sie wurde für 22.000 Euro vom Uhrenmuseum der Schweizer Stadt La-Chaux-de-Fonds erworben, die westlich von Bern nahe an der französischen Grenze gelegen ist. Die Uhr ist damit wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Im Auktionskatalog von 1955 findet sich auch eine 2,08 Meter hohe Standuhr von Landeck, die nur einen Zeiger hatte, der die Stunden und Minuten anzeigte. Eine Abbildung davon findet sich in der Schrift von Speckhart.
Literatur:
- Abeler, Jürgen: Meister der Uhrmacherkunst. Über 2000 Uhrmacher aus dem deutschen Sprachgebiet mit Lebens- oder Wirkungsdaten und einem Verzeichnis ihrer dem Autor bekannten Werke. 2.te Aufl. Wuppertal: Abeler 2000, S. 332-333
- Beyer, Leo: Der Nürnberger Stadtteil Mögeldorf. Eine Häusergeschichte. Nürnberg: Lorenz Spindler 1964, S. 77-78
- Gaab, Hans: Die geografische Kunstuhr von Homann. In: Regiomontanusbote 19 (3/2006), S. 25-31
- Giersch, Robert; Schlunk, Andreas; Haller, Bertholf Frhr. von: Burgen und Herrensitze in der Nürnbergischen Landschaft. Lauf an der Pegnitz: Selbstverlag der Altnürnberger Landschaft e.V., 2006, Herrensitz Nr. 173, S. 276
- Grieb, Manfred (Hrsg.): Nürnberger Künstlerlexikon Bd. 2. München: Saur 2007, S. 880
- Pilz, Kurt: 600 Jahre Astronomie in Nürnberg. Nürnberg: Hans Carl 1977, S. 311-312
- Speckhart, Gustav: Die Uhrmacherfamilie Landeck in Nürnberg und eine verschwundene Kunstuhr. Deutsche Uhrmacher-Zeitung 19, 1895, Nr. 22, S. 254-256
- Speckhart, Gustav: Johann Baptist Homanns der Römischen Kaiserlichen Majestät Geograph neulich erfundene Geographische Universal-Zeig- und Schlag-Uhr. Gefertigt anno 1705 von Zacharias Landeck, Stadtuhrmacher in Nürnberg. 1905 wieder aufgefunden und restauriert. Nürnberg: Stich 1907 [Stadtbibliothek Nürnberg: Nor. 1916 80]
- Zinner, Ernst: Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11.-18. Jahrhunderts. Nachdruck der 2.ten Aufl., München: Beck 1979, S. 423
Links:
- Uhren aus dem Museum in La Chaux-de-Fonds, darunter die von Landeck konstruierte Universaluhr
- Anzeige für Homanns Geographische Universal-Zeig und Schlag-Uhr, die von Landeck angefertigt worden war
- Beschreibung der Uhr in Friedrich Nicolais erstem Band seiner Reise durch Deutschland, 1783, S. 279
- Uhr von Pater Klein (1684-1742) aus Prag von 1738, die der Homann'schen Universaluhr nachgebaut wurde aus dem Bildarchiv der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden
- Wanduhr in quadratischem Holzgehäuse mit Verglasung aus dem Landesmuseum Württemberg
- Kleine Standuhr in Holzgehäuse mit verglasten Wandungen aus dem Landesmuseum Württemberg
- Wir danken Eva Beck von der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Weimar für freundliche Hinweise.
Fußnoten
- ↑ "23 [August 1670] Hanns Carl Landeck, Großuhrmacher, Katharina, Zacharias, Zacharias Coster, Amptmann in der Schau", Taufen St. Sebald 1655-1675, S. 761 (Scan 397).
- ↑ "☽ 19. hujus [September 1740] Der Erbar u. Kunstberühmte auch Mannveste Zacharias Landeck Stadt u. LandAllmoß. Amts: Uhrmachers [...] hinter St. Egidien", Bestattungen St. Sebald 1732-1740, S. 396 (Scan 220), Eintrag 152.
- ↑ "Der Erb. u. kunstr. Zacharias Landeck, Uhrmacher,
deß Erb. u. kunstr. Joh. Carl Landeck Stadt Uhrm. E. S. Die Erb. u. Tgs. J.
Ursula Barbara, deß Erb. Joh. Georg Schefflers S. N. E. T.
zu Wehrd cop.", Trauungen St. Sebald 1692-1727, S. 210 (Scan 109), Eintrag 43.
"24. [April 1702] Zacharias Landeck, Uhrmacher, Jfr. Ursula Barbara Schefflerin", Trauungen Wöhrd, St. Bartholomäus 1557-1727, S. 156 (Scan 159). - ↑ "10. [September 1680] Johann Georg Scheffler, Barbara, Ursula Barbara, Ursula, deß Georg Srey[?], Schuhmachers Ehewl.", Taufen St. Sebald 1676-1701, S. 254 (Scan 133).
- ↑ "♀ d. 31. Octobris [1760] Die Erbar und Ehrentugendsame Frau Ursula Barbara, des Erbar, kunsterfahrnen und Mannvesten Zacharias Landeck, Stadt- U. Land Almoß Amts-Uhrmachers, auch unter unter der löbl. Burgerschaft Lieutenants, S. N. W. hinter St. Egidien aetat. im 81. Jahr", Bestattungen St. Sebald 1755-1768, S. 221 (Scan 154), Eintrag 144.
- ↑ "Landeck Zacharias Uhrmacher, Ursula Barbara, Johann Adam, Haaß Merc., 21 [März 1704]", Taufen St. Lorenz 1693-1712, S. 481 (Scan 205).
- ↑ "Mögeldorf, ♂ den 26 Junii [1746]
Der Erbar u. Kunstreiche Johann Adam Landeck, Hof-Uhrmachers
zu Anspach, ein Jungergesell, des Erbarn und Kunstreichen auch MannVesten Zacharias Landeck,
Stadt- u. Land-Almoß-Uhrmachers, u. unter der löbl. Burgerschafft Lieutenants
in Nürnberg Seel. nachgelassener ehel. Sohn: Und die Erbar u. Ehrentugendreiche
Jgfr. Anna Maria, des Erbarn u. fürnehmen Andreas Segers Seel. nach gelassene ehel. Tochter.
Sind auf Oberherrl. Erlaubnuß und Concession, im Pfarr-Hauß allhier,
ehel. [...] copuliert worden",
Trauungen Mögeldorf-St. Nikolaus und Ulrich 1730-1888, S. 92 (Scan 78).
"Der Erb. u. kstr. Johann Adam Landeck, Hofuhrmacher zu Anspach, des Erb. u. kunsterfahrnen auch Mannvesten Zacharias Landeck, Stadt- u. Land-Almos Uhrmachers, u. unter der löbl. Bürgerschafft Lieutl., S. N. E. S. Die Erb. u. Ehrentgdr. Jgfr. Anna Maria, des Erb. u. fürnhemen Andreas Segers, S. n. E. T.; ♂ d: 26. Jul [1746] zu Mögeldorf", Trauungen St. Sebald 1728-1754, S. 587 (Scan 303). - ↑ "21. [Oktober 1718], Andreas Seeger, Händler, Margareta, Anna Maria, Fr. Anna Maria, Conrad Paulus Kollmajer, Kannengiesers ux.", Taufen St. Sebald 1702-1724, S. 771 (Scan 399).
- ↑ "♀ 28. [Juli 1752] Landeckin Anna Maria, Johann Adam Landecks, Großuhrmachers Ehefrau", Bestattungen Ansbach-St. Johannis 1742-1772, S. 81 (Scan 83), Eintrag 204.
- ↑ "3. [Mai 1715] Zacharias Landeck, Stadt Uhrmacher, Ursula Barbara, Wolf Jacob Matthäus, Wolf Jacob Christian Handelsmann deßen;en Stelle vertretten Johann Martin Hans[?] Forster, Handelsmann", Taufen St. Sebald 1702-1724, S. 558 (Scan 287).
- ↑ "Mögeld. ♃ 3 Jul. [1794] Wolfg. Jacob Matthäus Landteck, Herzogl. Sachsen-Weimarischer Hof-Uhrmacher und Besitzer des Landtekl. Schloßes alhier Aet. 79 J. War eine Orgelleich. Er wurde in das Grab Num. 63: gelegt, so der Kirche gehöret", Bestattungsbuch Mögeldorf-St. Nikolaus und Ulrich 1730-1851, S. 373 (Scan 236), Eintrag 26.
- ↑ "Herr Wolfgang Jacob Mattheus Landeck, Fürstl. Hofuhrmacher allhier, bürtig von Nürnberg" wurde am 10.12.1750 mit Maria Philippina Lieber getraut. Die Eheschließung fand "auf Befehl des Fürstl. OberConsistorii ohne Proclamation" statt, "weil sie sich vor der Zeit in Unehre zusammen gefunden.", Traubuch 1739-1784 der Evan.-Luth. Stadtkirche Weimar, S. 62, 1750.
- ↑ "Mögeldorf, ♀ den 5 Junii [1772] Frau Maria Philippina, Wolfgang Jacob Matthäus Landteck gewesenen fürstl. Sachsen-Weimarischen Hof=Uhrmachers, u. dermaligen Besitzers des Landteckischen Schlosses alhier Eheliebste, aet 50 Jahr. Wurde auf der Canzel gelesen. Sie kam in das Grab Num. 13. Darin vor einigen Wochen, neml. Dom. Quasim. den 26 Apr. ihre Baase, Jgfr. Prechtin, geleget worden", Bestattungsbuch Mögeldorf-St. Niklaus und Ulrich 1730-1851, S. 256 (Scan 176), Eintrag 38.
- ↑ "3. [März 1717] Zacharias Landeck, Uhrmacher, Ursula Barbara, Christoph Achatius, Hr. Christoph Achatius Hülß, Hauptmann", Taufen St. Sebald 1702-1724, S. 673 (Scan 348).
- ↑ "☿ 6. hj. [Februar 1771] Christoph Achatius Landeck Stadt [...] Uhrmacher am Egidien Hof [...]", Bestattungen St. Sebald 1769-1779, S. 102 (Scan 89), Eintrag 17.
- ↑ "♂ d. 5. Jun. [1742] Der Erbar und Kunstreiche Christoph Achatius Landeck, Stadt-Uhrmacher, des Erbarn, Kunsterfahrnen und Mannvesten Zacharias Landeck, Stadt= und Allmoß=Amts=Uhrmachers, auch unter der löbl. Burgerschafft Lieutenants S. N. E. S. Die Erbar und Ehren Tugendreiche Jgfr. Susanna Maria, des Erbarn und fürnehmen Hieronymus Filtzhoffer E. T. Tag-Amt im Pfarrhof auf dem Saal, mit 6. Personen" Trauungen St. Lorenz 1737-1789, S. 134 (Scan 140), Eintrag 60.
- ↑ "Der Erbar und Fürnehm Hieronÿmus Filzhofer, aufm Roßmackt. ♀, den 22. d. [März 1748] Dreÿerl. St. Roch.", Bestattungen St. Lorenz 1742-1789, S. 92 (Scan 101), Eintrag 35.
- ↑ "8. [Juni 1721] Zacharias Landeck, Uhrmacher, Ursula Barbara, Joh. Melchior, Joh. Melchior Landeck, Anschicker in der Peunt", Taufen St. Sebald 1702-1724, S. 917 (Scan 475).
- ↑ "☽ d. 16. Julii [1759] Joh. Melchior Landeck, Kupferstecher in d. N. Gaß am Spitalkirchhof. NB. ward früh in einer Kutschn hinaus gefahren, zahlt eine Dreÿherrn Leich", Bestattungen St. Sebald 1755-1768, S. 155 (Scan 120), Eintrag 95.
- ↑ Der Erbar und Kunstberühmte Johann Melchior Landeck, Kupferstecher, des Erbar= Kunstberühmten und Mannvesten Zacharias Landeck, Stadt= Land= und Allmos Uhrmachers auch unter der löbl. burgerschafft Lieutenants S. H. E. S. Die Erbare und Ehrn Tugendreiche Jungfer Anna Margaretha, des Erbarn und Kunstberühmten Sebastian Dorn, Kupferstechers E. T. cop. ☽ d. 24. April [1758] Frühm.", Trauungen, St. Sebald 1755-1793, S. 68 (Scan 38).
- ↑ Lebensdaten nach Grieb 2, 2007, S. 880.
- ↑ Lebensdaten nach Grieb 1, 2007, S. 281.
- ↑ "Am 13. Nov. [1822] starb an Wassersucht Johann Caspar Landeck, vormals gewesener Schloßbesitzer und Kleinuhrmacher in Mögeldorf, gebohren in Weimar, in großer Dürftigkeit 71 Jahr 7 Mon. 14 Tage alt und wurde mit Alter Leiche beerdigt", Bestattungen Mögeldorf, St. Niklaus und Ulrich 1730-1851, S. 536 (Scan 327).